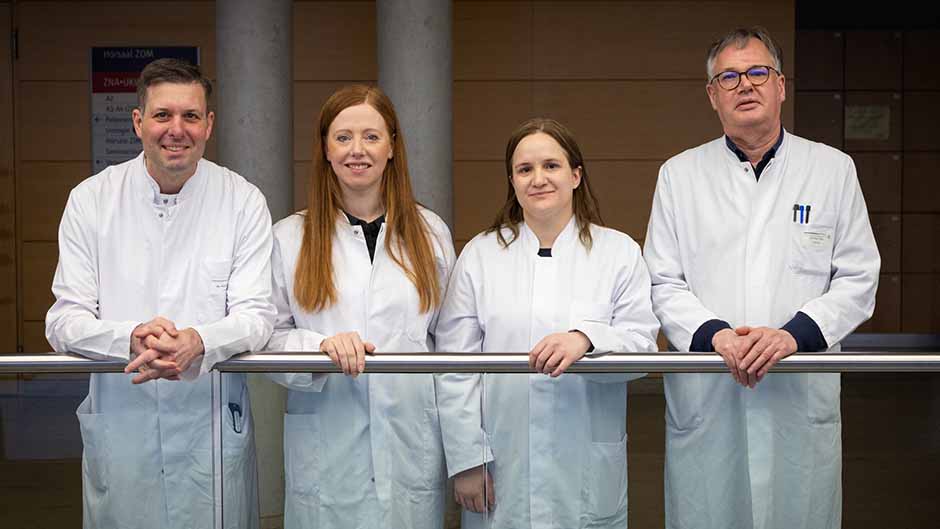Bioprinting stellt eine Zukunfts-Technologie dar, die das Potenzial hat, die Medizin grundlegend zu verändern. Mithilfe des 3D-Druckverfahrens wird lebendes Gewebe aus patienteneigenen Zellen hergestellt, mit dem langfristigen Ziel, vollständige Organe für Transplantationen zu erzeugen. Diese Entwicklung könnte demnächst den Organmangel beheben und die Risiken von Abstoßungsreaktionen minimieren.
Lebensbedrohliche Krankheiten oder der Verlust wichtiger Organfunktionen machen eine Organtransplantation häufig notwendig. Auf den Wartelisten der europäischen Vermittlungsstelle Eurotransplant stehen derzeit etwa 8.400 Patientinnen und Patienten aus Deutschland. 9192 Patienten standen Ende des Jahres 2020 bei Eurotransplant auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die mit Abstand größte Nachfrage besteht bei Nieren (7338). Es folgen Lebern (891) und Herzen (700), danach Bauchspeicheldrüse (100) und Lunge (280). Das erste 3D-gedruckte Organ, das einem Menschen transplantiert wurde, war eine Blase, die 1999 von Wissenschaftlern des Wake Forest Institute for Regenerative Medicine hergestellt wurde. Das Organ ist mehr als zwei Jahrzehnte noch voll funktionsfähig.
Organe für Transplantationen
Das Bioprinting basiert auf speziellen 3D-Drucktechniken, die sogenannte Bioinks verwenden – biokompatible Materialien, die lebende Zellen enthalten. Diese Bioinks werden schichtweise aufgetragen, um komplexe Gewebestrukturen nachzubilden. Unterstützt wird dieser Prozess durch computergestützte Modellierung, die eine präzise Reproduktion anatomischer Strukturen ermöglicht. Aktuelle Fortschritte in der Zellkulturtechnologie und Materialwissenschaft tragen dazu bei, die Lebensfähigkeit der gedruckten Zellen zu erhöhen.
Anwendungen und Potenziale
Schon heute wird Bioprinting für die Herstellung von Hautgewebe, Knorpel und einfachen Organstrukturen wie Mini-Lebern genutzt. In der personalisierten Medizin könnte diese Technologie individuell angepasste Transplantate ermöglichen, die aus den eigenen Zellen eines Patienten gezüchtet werden. Dies reduziert nicht nur das Risiko der Immunabstoßung, sondern vermeidet auch ethische Probleme im Zusammenhang mit Spenderorganen.
Um menschliche Organ im 3D-Biodrucker zu produzieren, müssen Forscher Baupläne für die Drucker erstellen, also Karten von menschlichen Organen. In ihnen ist skizziert, wie Blutgefäße, Nervenzellen und Lymphbahnen im gesunden Zustand genau zusammenarbeiten. Um dieses komplexe Zusammenspiel zu ergründen, haben die Wissenschaftler (Helmholtz-Gemeinschaft 2025) biochemische Verfahren entwickelt, mit denen menschliche Organe durchsichtig werden. Dadurch können spezielle Mikroskope die Lage jeder einzelnen Zelle in einem Organ bestimmen. Dabei entsteht eine hohe Datenmenge, so dass eine künstliche Intelligenz sie zu einem 3D-Modell verarbeiten kann. Diese Modelle dienen dann als Grundriss für den Bauplan eines Organs.
Herausforderungen und Zukunftsaussichten
Trotz vielversprechender Fortschritte gibt es noch erhebliche Herausforderungen. Die Sicherstellung einer funktionierenden vaskulären Versorgung innerhalb der gedruckten Gewebe ist essenziell, um größere Organe überlebensfähig zu machen. Zudem sind regulatorische Hürden und hohe Kosten bedeutende Hindernisse für die klinische Anwendung. Dennoch könnten in den nächsten Jahrzehnten biogedruckte Organe eine praktikable Alternative zu Spenderorganen werden.
Zusammenfassend bietet das Bioprinting immense Möglichkeiten für die regenerative Medizin. Während weitere Forschung erforderlich ist, bleibt die Technologie eine vielversprechende Lösung für den Organmangel und die Entwicklung personalisierter medizinischer Behandlungen.
Autor: Wolf-Dietrich Lorenz
Foto: Adobe Stock / keetazalay