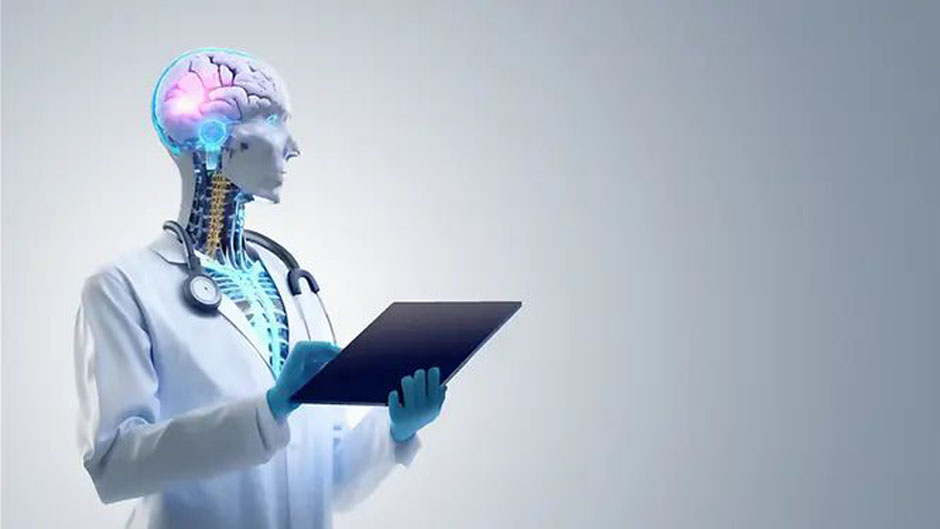Am 13.02.2025 veröffentlichte die Entscheiderfabrik folgende Erklärung:
Wir haben es den politisch Verantwortlichen vorhergesagt: eine Krankenhausreform aus dem Hinterzimmer, die nicht ausreichend alle Beteiligte einbezieht, wird nicht zum Ziel führen. Der zuständige Minister Lauterbach hat seiner Reform keine lösungsorientierte Bestandsaufnahme vorangestellt und weder die Krankenhausmanager noch die Deutsche Krankenhausgesellschaft einbezogen und, was uns deutlich schmerzt, nicht für ausreichende Finanzmittel gesorgt.
Damit passiert genau das, was wir seit einiger Zeit anmahnen: die Lücke zwischen den erheblichen Kostensteigerungen auf der einen Seite und den systembedingt stagnierenden Erlösen führt immer mehr Häuser in die akute Insolvenzgefahr. Selbst gut geführte Einrichtungen stehen in diesen Tagen vor schwerwiegenden Entscheidungen: sie müssen gegen ihre Überzeugungen medizinisch sinnvolle und bedarfsnotwendige Angebote streichen, weil sie sich nicht mehr lohnen. Wer dieser Logik nicht folgt, gefährdet am Ende das gesamte Unternehmen – wir sind empört, dass die Politik uns und die Patienten in dieser Form im Stich lässt.
Diese Krankenhausreform, das KHVVG hat ganz erheblich Mängel:
- Sie gefährdet die flächendeckende Versorgung
- Sie berücksichtigt die regionalen Besonderheiten nur mangelhaft
- Sie unterstützt die Kliniken finanziell unzureichend
- Sie steigert den bürokratischen Aufwand
- Sie greift in die Planungshoheit der Länder ein
Zu 1) - das KHVVG gefährdet die flächendeckende Versorgung
Diese Reform führt zu einer Konzentration von Leistungen weit über das notwendige Maß hinaus. Vor allem kleinere Kliniken in ländlichen Regionen sind schon erheblich unter wirtschaftlichem Druck, er wird sich existenzbedrohlich weiter verschärfen. Im Ergebnis gefährdet das die Versorgung der Menschen!
Deshalb schlagen wir vor:
Die Finanzierung muss regionalisiert werden. Wir brauchen einen Mechanismus, um die ländlichen und strukturschwachen Regionen in Deutschland gezielt zu stärken, weil die Menschen dort ansonsten unterversorgt sind. Wir müssen auch kleinere Kliniken erhalten, spezielle fallzahlunabhängigeStrukturkosteninstrumente für versorgungsrelevante Einrichtungen in ländlichen Gebieten können dabei helfen.
Zu 2) das KHVVG berücksichtigt die regionalen Besonderheiten nur mangelhaft
Der Gesetzgeber macht bundeseinheitliche Vorgaben, die keine regionalen Besonderheiten berücksichtigt. Das erschwert die bedarfsgerechte Planung vor Ort – also dort, wo die Versorgung der Patienten erfolgen muss.
Deshalb brauchen wir:
Regionale Auswirkungsanalysen durch unabhängige Gremien, die die lokalen Bedürfnisse. berücksichtigen, sie gehören zwingend dazu. Der Leistungskatalog muss flexibilisiert werden. Kliniken sollen sich auf die regionalen Gegebenheiten einstellen, zum Beispiel durch Schwerpunktbildung.
Zu 3) das KHVVG unterstützt die Kliniken finanziell unzureichend
Die Klinikverbände machen darauf aufmerksam, dass eine jede Reform erhebliche finanzielle Mittel erfordert, jede Veränderung braucht Investitionen. Da die Länder in der Vergangenheit zu wenig Investitionsmittel bereitgestellt haben, verschärft sich die Lage weiter. Wir sind zu Anpassungen bereit, müssen aber darauf pochen, dass dieser Prozess auskömmlich finanziert wird im Bereich der Investitionen und der Betriebskosten.
Deshalb schlagen wir vor:
Die Finanzierung muss dynamisiert werden: Inflation, steigende Energiekosten und Personalkosten müssen jeweils berücksichtigt werden. Darüber hinaus brauchen wir einen Rettungsfonds für die kurzfristige Unterstützung regional wichtiger Kliniken, die sich in akuten Schwierigkeiten befinden.
Zu 4) das KHVVG steigert den bürokratischen Aufwand
Neue Leistungsgruppen und kleinteilige Qualitätsvorgaben erfordern weiteren bürokratischen Aufwand. Obwohl immer wieder versprochen wird, diese Belastungen zu reduzieren, passiert in der Praxis genau das Gegenteil. Das bindet jene Ressourcen, die wir viel lieber in die Patientenversorgung stecken wollen.
Deshalb brauchen wir:
Die Krankenhausverwaltung muss zwingend digitalisiert werden. Dokumentationspflichten sind so anzulegen, dass sie automatisiert werden können und den Arbeitsaufwand reduzieren – nicht, wie bisher, häufig erhöhen. Berichts- und Nachweispflichten müssen so schlank ausgestaltet werden, dass sie denbürokratischen Aufwand senken und nicht vergrößern.
5) das KHVVG greift in die Planungshoheit der Länder ein
Die Bundesländer beklagen zu Recht, dass ihre Kompetenzen in der Krankenhausplanung beschnitten werden. Der Bund greift zur stark in das regionale Geflecht und die Zuständigkeit ein. Die daraus resultierenden Spannungen zwischen Bund und Ländern sind nicht zielführend und verschleudern Energien.
Deshalb schlagen wir vor:
Wir brauchen eine kooperative Planung zwischen Bund und Ländern. Die Bedarfspläne und die Ausgestaltung des Gesetzes müssen zwingend gemeinsam gestaltet werden. Wir plädieren im übrigen für mehr finanzielle Anreize, sie entfalten eine größere Wirkung als zentrale Vorgaben. Damit wird die Eigenständigkeit der Länder respektiert.
Eine weitere Baustelle ist die Digitalisierung, das KHZG hilft nur begrenzt:
- Es erhöht den bürokratischen Aufwand und führt zu uneinheitlichen Verfahren in den Ländern
- Die Potentiale digitaler Versorgungskonzepte werden nicht ausreichend berücksichtigt; es fehlende Anreize und die erforderlichen Rahmenbedingungen
- Wir sehen unklare Förderkriterien und zu große Interpretationsspielräume
- Regionale Unterschiede werden auch hier nicht ausreichend berücksichtigt
- Die erheblichen Folgekosten der Digitalisierung werden nicht gedeckt
- Der Zeitrahmen für die Umsetzung ist zu eng bemessen
Zu 1) das KHZG erhöht den bürokratischen Aufwand und führt zu uneinheitlichen
Verfahren in den Ländern
Der gesamte Antragsprozess ist mit unnötig hohem bürokratischem Aufwand verbunden. Jedes Bundesland hat eigene Regeln und Formulare entwickelt. Das führt zu längeren Wartezeiten und ist höchst ineffizient.
Deshalb schlagen wir vor:
Wir brauchen einen zentralen Koordinierungsrahmen. Es muss ein bundesweit einheitlicher Leitfaden für die Antragsstellung, Bewilligung und Umsetzung geschaffen werden. Wir brauchen eine digitale Antragsplattform. Sie muss bundesweit auf standardisierte Prozesse ausgerichtet sein, um den bürokratischen Aufwand zu minimieren.
Zu 2) das KHZG ignoriert die Potentiale digitaler Versorgungskonzepte
Telemedizin und digitale Versorgungsverbünde werden im KHZG nicht berücksichtigt. Im Vordergrund stehen Standortdenken und analoge Versorgungskonzepte.
Deshalb schlagen wir vor:
Digitale Versorgungsangebote müssen gleichwertig berücksichtigt werden. Die Vorgaben zu den Leistungsgruppen müssen auch die Telemedizin und digitale Verbünde als gleichwertigeVersorgungsangebote anerkennen.
Zu 3) das KHZG hat unklare Förderkriterien und zu große Interpretationsspielräume
Die Förderrichtlinien lassen zu große Interpretationsspielräume. Dies führt zu Unsicherheiten und kostet wertvolle Zeit. Es ist zum Beispiel unklar, welchen Durchdringungsgrad Spracherkennungssysteme haben müssen, damit sie die Anforderungen erfüllen.
Deshalb brauchen wir:
Klarheit und Transparenz in den Förderkriterien, sie müssen verbindlich veröffentlicht werden. Wir schlagen regelmäßige Schulungen und Informationsveranstaltungen für die Klinikleitungen und Ländervertreter vor, damit Interpretationsspielräume verringert werden.
Zu 4) auch das KHZG berücksichtigt regionale Unterschiede nicht ausreichend
Das KHZG wird in den Ländern administriert. Jedes Bundesland hat eigene Fördermittel-, Haushalts- und Vergaberegeln entwickelt – dieser Wildwuchs ist nicht zu erklären und erschwert effiziente Prozesse.
Deshalb schlagen wir vor:
Wir brauchen regionale Förderquoten, die den spezifischen Anforderungen von städtischen und ländlichen Kliniken Rechnung tragen. Wir sollten regional priorisieren, damit die jeweiligen Versorgungsbedarfe adäquat berücksichtigt werden.
Zu 5) das KHZG deckt nicht die erheblichen Folgekosten der Digitalisierung
Das KHZG fördert die Investitionen in die dringend benötigte Digitalisierung. Völlig unklar und nicht geregelt sind die erheblichen Folgekosten für die Schulung der Menschen sowie die Wartung. Die Krankenhäuser können das aktuell nicht stemmen.
Deshalb schlagen wir vor:
Der Förderrahmen muss erweitert werden. Die Betriebskosten sowohl für die digitale Infrastruktur als auch die Wartung und die Schulung gehören unzweifelhaft zusammen. Wir brauchen einen langfristigen und dauerhaften Fonds, der die Kliniken bei der Digitalisierung unterstützt.
Zu 6) das KHZG bemisst den Zeitrahmen für die Umsetzung zu eng
Die Fristen sind zu knapp bemessen. Das Antragsverfahren dauert zu lange und die neuen Projekte können kaum im gesetzten Zeitrahmen fertig gestellt werden. Das überfordert viele Kliniken.
Deshalb brauchen wir:
Einen gestaffelten Zeitplan, der den Kliniken die Möglichkeit gibt, Projekte in Etappen umzusetzen und dabei auf gemachte Erfahrungen zurückgreift. Die Fristen müssen flexibilisiert werden, deshalb schlagen wir Ausnahmeregeln vor, damit auch jene Kliniken vorankommen, die aus finanziellen oder regionalen Gründen die Umsetzungsfristen nicht einhalten können.
Die Kritikpunkte verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen Krankenhausgeschäftsführer stehen. Wir hoffen, dass sich die neue Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen den angeführten Verbesserungsvorschlägen annimmt und somit aktiv zur Lösung der Herausforderungen beiträgt.
Foto: v. l. n. r. Prof. Dr. Jürgen Wasem, Dr. Hans Christian Atzpodien, Dr. Jens Schick, Dr. Uwe Gretscher, Jürgen Zurheide, Dr. Axel Paeger, Dr. Gerald Gaß, Martin Große-Kracht, Wolfgang Mueller
Quelle: Entscheiderfabrik